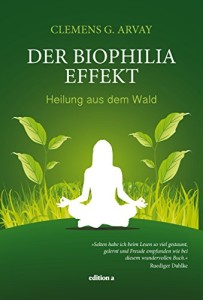Bäume sind weit mehr als nur Sauerstoffproduzenten Holzlieferanten und Schattenspender. Sie sind intelligente, lebendige Wesen, die mit ihresgleichen und ihrer Umwelt kommunizieren und lebenslange Freundschaften bilden können – das hat nun sogar die Wissenschaft ermittelt. Zudem haben sie eine heilende Wirkung auf uns Menschen – wenn wir denn nur mal in den Wald oder Park gehen würden!
Der Förster und Naturschützer Peter Wohlleben stieß eines schönen Tages in seinem Buchenwaldreservat auf auffällig bemooste Steine. Bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass es sich dabei nicht um Steine, sondern um die Überreste eines riesigen, uralten Baumstumpfes handelte. Der Baum selbst war vor etwa vier- bis fünfhundert Jahren gefällt worden. Doch warum waren diese Überreste noch nicht verfault und zu Humus geworden? Warum waren sie über Wurzeln noch fest mit dem Erdreich verbunden und warum gab es unter dem Moos und der Rinde noch eine grüne Schicht – sprich Leben? Wie war das möglich?
Damit ein Baum überleben kann, brauchen seine Zellen Nahrung in Form einer Zuckerlösung und sie müssen atmen. Doch ohne Blätter und damit folglich ohne Fotosynthese ist dies eigentlich unmöglich. Was also ließ den Stumpf all die Jahre überleben? Die Antwort ist so einfach wie verblüffend: Die umliegenden Buchen versorgten den Baumstrunk über ihre Wurzeln mit der Zuckerlösung und hielten ihn so über Jahrhunderte am Leben!
Wälder verfügen also über eine Art „Sozialsystem“. Denn Bäume, so hat man herausgefunden, haben die Fähigkeit, sich mit artgleichen Exemplaren zusammenzuschließen und ein Baumnetzwerk zu bilden! Dazu verbinden sich Bäume direkt über Wurzelverwachsungen; manchmal sind ihre Wurzeln aber auch nur lose über ein Pilzgeflecht miteinander vernetzt. Über diese Wurzelverbindungen werden dann Nährstoffe und Informationen ausgetauscht.
Doch wer jetzt denkt, dass dies alles planlos geschieht und Bäume einfach zufällige Zweckgemeinschaften schließen, der irrt gewaltig. Massimo Maffei von der Universität Turin hat festgestellt, dass Pflanzen (und folglich auch Bäume) ihre eigenen Wurzeln von jenen fremder Spezies und sogar von anderen Exemplaren der eigenen Art unterscheiden können. Bäume gehen diese Wurzelvernetzungen untereinander also bewusst ein! Was Wälder somit zu Superorganismen macht.
Doch was ist der Grund, für diese soziale Art der Bäume? Ist es reine Nächstenliebe oder steckt vielleicht mehr dahinter? Sowohl als auch. Ein Baum alleine macht noch lange keinen Wald. Nur in der Gemeinschaft können Bäume ein eigenes Ökosystem bilden, das Hitze- und Kälte-extreme abfedert, Wasser speichern und sehr feuchte Luft erzeugen kann. Deshalb zählt jeder einzelne Baum im Wald. Ständige Todesfälle würden viel zu viele Löcher in das schützende Kronendach reißen. Dies wiederum würde es Wind und Wetter erlauben, stärker in den Wald zu dringen und so das Klima durcheinanderzubringen. Deshalb werden sogar kranke Bäume von ihren Baumkollegen unterstützt und mit Nährstoffen versorgt, bis es ihnen wieder besser geht.
Ein Baum kann sich nicht wirklich aussuchen, wo er steht. Er wächst einfach dort, wo sein Samen gefallen ist. Daher gibt es Bäume, die an sehr günstigen und wasserreichen Standorten stehen, andere wiederum sind auf wasserarmem oder gar felsigem Untergrund gelandet. Das Nährstoffangebot des Waldbodens kann sich innerhalb von wenigen Metern drastisch unterscheiden. Faszinierenderweise gleichen Bäume diese standortbedingten „Ungerechtigkeiten“ untereinander aus. Vanessa Bursche von der RWTH Aachen fand heraus, dass in ungestörten Buchenwäldern jede Buche die gleiche Leistung erbringt. Wer viel hat, der gibt ab – und wer wenig hat, der empfängt. So einfach ist das. Im Wald scheint die Umverteilungs-politik problemlos zu funktionieren.
Förster aus Lübeck fanden zudem heraus, dass ein Buchenwald ohne menschliches Eingreifen gar produktiver ist. Der Förster denkt gemeinhin, dass Bäume Platz zum Wachsen brauchen, und schlägt daher etwa alle fünf Jahre Bäume, um den Wald zu lichten. Doch dies ist fatal. In Lübeck zeigte sich, dass Buchen von sich aus sehr dicht stehen. Förster Wohlleben nennt dies denn auch „Gruppenkuscheln im Walde“. Die Bäume suchten von sich aus die Nähe zu Artgenossen. Im erwähnten Lübecker Wald haben die Bäume Wasser und Nährstoffe so optimal unter einander verteilt, dass jeder einzelne Baum zur Höchstform auflaufen konnte – egal wie gut oder schlecht der Standort war. Wenn nun aber ein Förster in den Wald geht und in gutem (aber falschem!) Glauben zu „aufdringliche“ Bäume schlägt, dann fehlen da plötzlich Mitglieder in der Gemeinschaft und die verbleibenden Exemplare werden zu Einsiedlern. Denn ihre Kontakte führen plötzlich ins Leere.
Nun macht jeder Baum sein eigenes Ding, was zu enormen Unterschieden in der Produktivität führt. Die einen Bäume wachsen wie wild in die Höhe, wohingegen die schwächeren Exemplare ins Hintertreffen geraten und immer hinfälliger werden. Mit dem Resultat, dass sie viel leichter zum Opfer von Pilzen und Bakterien werden. Der Tod dieser Bäume reißt dann wiederum neue Löcher ins Kronendach, und der Negativ-Kreislauf beginnt erneut.
Doch kommen wir noch einmal auf den eingangs erwähnten Baumstrunk zurück: Stirbt ein Baum eines natürlichen Todes, so verfault der Baumstrunk in der Regel innerhalb von wenigen Jahrzehnten und wird wieder zu Humus. Doch warum wurde dann besagter Baumstumpf noch nach Jahrhunderten am Leben gehalten – obwohl der Baum ja eigentlich bereits tot war? Ganz einfach: Weil der Baum zu Lebzeiten Freunde hatte! Denn Bäume bilden nicht nur Netzwerke, sie können auch echte Freundschaften schließen! Wer öfter mal in Baumkronen schaut, der kann dies erkennen.
Ein normaler „Durchschnittsbaum“ macht sich oben so lange breit, bis er mit seinen Ästen an die Zweigspitzen seines Nachbarn stößt. Zudem werden die Ausleger kräftig verstärkt, sodass der Eindruck entstehen kann, da oben werde um die besten Plätze gerungen. Ein echtes Freundespaar hingegen gibt von vornherein Acht, dass keine dicken Äste in Richtung des Freundes gebildet werden. Die Freunde möchten sich gegenseitig nichts wegnehmen und bilden daher die dicken Kronenteile nur nach außen hin zu den „Nichtfreunden“. Laut Autor Wohlleben treten diese Freundschaften meist jedoch nur in natürlichen Wäldern auf. Bei gepflanzten Forsten, wie es die meisten Nadelwälder Mitteleuropas sind, verhalten sich die Bäume eher wie „Straßenkinder“. Denn ihre Wurzeln wurden bei der Pflanzung dauerhaft beschädigt, weshalb sie offenbar kein Netzwerk bilden können. Jeder wurschtelt einfach so vor sich hin und wächst irgendwie, ohne Rücksicht auf Verluste. Seien es die eigenen oder die der Nachbarn.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass Bäume zwar Netzwerke und Freundschaften bilden, jedoch nur mit artgleichen Exemplaren. Da stört es auch nicht, wenn Bäume nach gängiger Lehrmeinung zu dicht stehen. Unter artfremden Bäumen herrscht jedoch ein Konkurrenzdenken und sie kämpfen gegeneinander um die lokalen Ressourcen. Dies sollte beim Baumpflanzen beachtet werden.
Da Bäume sich aktiv miteinander verbinden und Freundschaften pflegen, liegt der Gedanke nicht fern, dass sie auch miteinander kommunizieren können. Und ja, das können sie wirklich. Wenn auch auf verschiedene Arten und Ebenen. Kommunikation bedeutet ja nichts anderes als das Aussenden und Empfangen von Informationen. Der Mensch macht dies über die gesprochene Sprache, Körperhaltung und Gesten.
Bäume kommunizieren natürlich nicht mit knarrenden Ästen und raschelnden Blättern, sondern unter anderem über Duftstoffe, sogenannte Pheromone. Dies sind Botenstoffe, die nach außen abgegeben werden. Übrigens verfügen auch wir Menschen über diese Duftstoffe, die wir bewusst und unbewusst wahrnehmen. Pheromone sind der Grund, warum wir gewisse Leute einfach „nicht riechen können“, uns zu anderen jedoch regelrecht hingezogen fühlen. Diese Duftstoffe sind dann laut der Wissenschaft auch daran beteiligt, welchen Partner wir letztendlich wählen. Und Bäume kommunizieren auf die gleiche Art und Weise miteinander. Erstmals groß entdeckt wurde diese Art der Verständigung von Bäumen vor mehr als vierzig Jahren: Die Blätter der Schirmakazie der afrikanischen Savanne stehen auf dem Speiseplan von Giraffen. Damit der Baum nicht irgendwann völlig kahl gefressen ist, schützt er seine Blätter mit Dornen auf den Ästen. Doch das hindert die Giraffe keineswegs am Naschen. Deshalb kann die Schirmakazie innerhalb von Minuten Giftstoffe in ihre Blätter einspeisen, die der Giraffe gehörig den Appetit verderben. Die Giraffe ihrerseits ist dann gezwungen, zum nächsten Baum zu gehen.
Doch sie bedient sich nicht einfach am Nachbarbaum. Nein, sie wandert etwa hundert Meter weiter und frisst erst bei diesen Bäumen. Denn sie weiß, dass die Bäume sich gegenseitig warnen. Wird eine Akazie angeknabbert, verströmt diese das Warn-Gas Ethylen, das alle umstehenden Bäume dazu veranlasst, ebenfalls Giftstoffe in ihre Blätter zu pumpen. Diese Duftstoffe haben jedoch nur eine Reichweite von hundert Metern, weshalb die Giraffe auch so weit läuft. Oder aber sie bewegt sich gegen den Wind und den Warnstoff und frisst die Blätter der ahnungslosen Bäume (Körper und Geist: Warum Waldspaziergänge so gesund sind).
Quelle: zeitenschrift.com
Weitere Artikel:
Pflanzen am Lügendetektor: Die Gefühle des Drachenbaums (Videos)
Mehr als drei Billionen Bäume bevölkern die Erde
Almendro – Baum des Lebens (Video)
Das geheime Leben der Bäume (Videos)
Pflanzen kommunizieren mit uns – warum wir die Natur brauchen
Unsichtbare Welt: Isländer nehmen Rücksicht auf ihre Naturgeister (Video)
Waldbaden: In Japan ist das Bäume umarmen eine Wissenschaft
Bewusstsein, Natur und mystische Welterfahrung
Der Wald ist auch Erholungsraum für die Seele
Haben Bäume Rechte? Plädoyer für die Eigenrechte der Natur
Inventur im Wald: Der grüne Alleskönner
Wunderbaum der Naturheilkunde: Kenia forstet auf, für größere Wälder und gegen den Krebs (Video)
Das Geheimnis der Bäume (Videos)
Eckhart Tolle: Kraft der Natur (Video)
Wie natürlich sind Deutschlands Landschaften
Minimalismus: 25 Tipps für ein befreites Leben
Wald: Kahlschlag im Naturschutzgebiet (Video)
Körper und Geist: Warum Waldspaziergänge so gesund sind
Aromatherapie: Helfen ätherische Öle gegen Krankheiten?
162 Jahre alter Mönch: Das Phänomen – Zwischen Leben und Tod (Video)
Idiokratie: “Wir werden fremdgesteuert!”
Die heilende Sprache der Pferde (Video)
Die wunderbare Welt der Baumhäuser (Videos)
Atem – Stimme der Seele (Video)
Das Geheimnis der Bäume (Videos)
Studie beweist erstmals: Meditation bewirkt Veränderungen in der Genexpression
Pflanze lebt seit 40 Jahren in verschlossener Flasche
Der Geist ist stärker als die Gene (Videos)
Auswertung von Satellitenbildern: Weltweit verschwinden Millionen Quadratkilometer Wald (Video)
Trotz ohne Hirn: Auch Pflanzen können sich erinnern und lernen
Die Neurowissenschaften entdecken die fernöstliche Meditation (Videos)
Die CO2 Lüge – Panik für Profit: Einfluss des Universums, Geoengineering und Ende der Eiszeit
Weden – Chronik der Asen (Video)
Goldsucher in Peru: Wie die Finanzkrise den Regenwald zerstört (Video)
Ich, Giordano Bruno: Die unheilige Allianz mit der Kirche (Videos)
Was wir von den alten Maya über Lebensqualität lernen können
Licht aktiviert das Gehirn selbst bei vollständig blinden Menschen
Meditation: Entspannung für das Gehirn (Videos)
Die Wirklichkeit ist ein Konstrukt des Bewußtseins (Videos)
Ewiges Amazonien: “Deutsches Stallvieh frisst amazonische Lebensvielfalt” (Videos)
Träume, auf Video aufgezeichnet
Brennholz-Klau im Wald: Die Diebe mit der Kettensäge – GPS-Sender sollen Abhilfe schaffen
Leben wir in einer Computersimulation? Forscher suchen nach der Grenze der Matrix (Video)
Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (Hörbuch)
Gehirnscans und die wahren Auswirkungen von Liebe
Der Mensch, das entrechtete Wesen
Die narzisstische Störung in berühmten Werken der Popkultur (Videos)
Jean-Jacques Rousseau: Nichts zu verbergen (Video)
Mensch – hör auf Dein Herz! (Videos)
Reise ins Ich: Das Dritte Auge – Kundalini – Licht und Sonnenbrillen (Videos)
Wenn Lärm krank macht – Von Schlafstörungen bis Herzinfarkt
Massen-Hypnose durch Kino und Fernsehen (Video)
Meditation: Entspannung für das Gehirn (Videos)
Ode an die Freude – Freiheit: Wohnen zwei Herzen (Seelen) in unserer Brust? (Video)
Gregg Braden: Liebe – Im Einklang mit der göttlichen Matrix (Video-Vortrag)
Das Auge des Horus – mystisches Licht der Seele (Videos)
Brel/Hoffmann: Wenn uns nur Liebe bleibt (Video)
Friedrich Schiller: “Die Räuber” von heute…
Immanuel Kant: Was ist Aufklärung? (Video)
Pachakútec – Zeit des Wandels – Die Rückkehr des Lichts (Video)