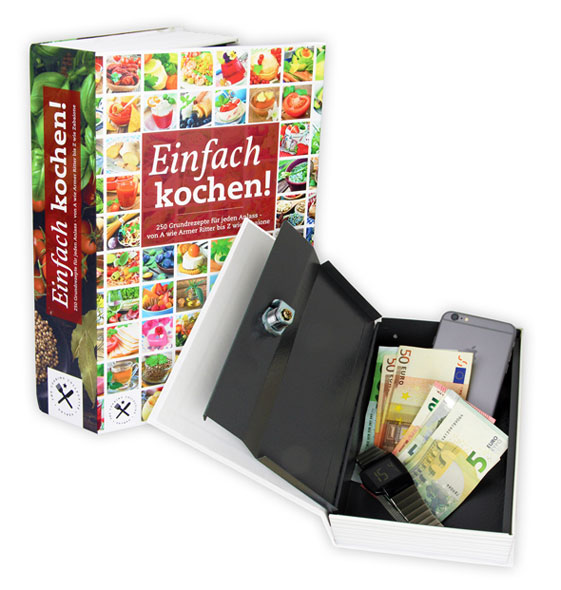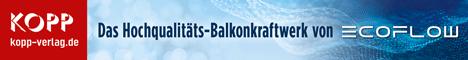

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, die Geldwäschebekämpfung zu verbessern und dabei den Launen der internationalen Schattenmacht FATF entgegenzukommen. Spendenfinanzierte Medien müssen dadurch noch mehr um ihre finanzielle Arbeitsgrundlage bangen. Eine Recherche von Hakon von Holst.
Es ist ein weltweites Phänomen: Banken kündigen immer öfter Journalisten, Medienunternehmen, politischen Aktivisten, aber auch gewöhnlichen Gewerbetreibenden. Eine überparteiliche Gruppe von Parlamentariern aus Großbritannien hat sich 2024 mit diesem »De-Banking«-Phänomen beschäftigt.
In seinem Bericht benennt das Gremium drei Hauptursachen. Dazu zählt einerseits das Reputationsrisiko: Banken überlegen sich, ob ihr Ansehen leidet, wenn die Presse bemerkt, dass ein Politiker wie Nigel Farage zur Kundschaft zählt.
Zum anderen geht es um den Verdacht auf illegales Handeln: Die Regeln und Vorschriften im Bereich der Finanzkriminalitätsbekämpfung nehmen immer größeren Raum ein.
Zu guter Letzt bleibt für die Banken zu klären, ob sich der Aufwand lohnt, dem Kunden auf den Zahn zu fühlen oder für die Geschäftsbeziehung ein Risiko einzugehen.
Sorgen um die Reputation und persönliche Vorbehalte spielen genauso in Deutschland eine Rolle. Am Beispiel des Medienunternehmens KenFM, Kunde bei der GLS-Bank, ließ sich das gut beobachten: Zuerst kam heftige Kritik an der Geschäftsbeziehung aus der Presse, dann ging das Geldinstitut auf Distanz und schlussendlich erging die Kündigung. (Drei schockierende Wahrheiten, die die meisten Menschen nicht über Geld auf Bankkonten wissen…)
Auch der Kampf gegen vermeintliche Finanzkriminalität kostet Medienschaffende immer öfter das Konto. In Verdacht geraten Journalisten, die auf Grundlage von Spenden arbeiten. Der Filmemacherin und Publizistin Gaby Weber beispielsweise kündigte im Februar mit Wirkung 5. Mai die Bank Comdirect das Konto.
Diese hatte zuvor die Nutzung als Spendenkonto bemängelt und auf das Geldwäschegesetz, die Vorgaben von Aufsichtsbehörden und »Verhaltensregeln zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung« verwiesen. Ich bin mit mehreren weiteren Fällen vertraut. Die Frage ist: Weshalb zeigt sich das Phänomen sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern?
Ein Teil der Antwort lautet FATF. Diese Financial Action Task Force (dt.: Finanzarbeitsgruppe) wurde 1989 am Rande eines Gipfels der G7-Staaten gegründet.
Mit dem erklärten Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, entwickelte sie sich zur globalen Schattenmacht, die im Hinterzimmer Standards erarbeitet, denen möglichst die Gesetzgeber aller Länder folgen sollen. Schon 1991 folgte die erste europäische Geldwäscherichtlinie, wie in Gablers Wirtschaftslexikon steht.
Bei der FATF handelt es sich um ein informelles Gremium von Vertretern der nationalen Finanz- und Sicherheitsbehörden, das formal keine bindenden Vorgaben machen kann.
Aber die Bundesbank bestätigt auf Anfrage, dass die »Anforderungen der FATF historisch gesehen in die europäische Mindestharmonisierung zur Geldwäscheprävention eingeflossen sind und dann im Wege der Umsetzung der bisherigen Geldwäscherichtlinien in nationales Recht durch die Mitgliedstaaten aufzugreifen waren«. 2027 tritt die EU-Geldwäsche-Verordnung in Kraft. Sie kommt der FATF zum Beispiel mit einem Barzahlungsverbot ab 10.000 Euro entgegen und muss nicht mehr in nationales Recht umgesetzt werden, um Wirkung zu entfalten.
Hellhörig machte mich folgender Fall: Ein Journalist, der Spenden auf sein Konto einwarb, erhielt aus heiterem Himmel ein Kündigungsschreiben der Bank.
Das Vorgehen begründete das Geldinstitut am Ende mit Handlungsanweisungen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU). Die Behörde nenne die Nutzung von Privatkonten zur Sammlung von Spenden und deren nachfolgenden Transfer ins Ausland als möglichen Fall von Terrorismusfinanzierung. Zu den verdächtigen Verhaltensmustern zähle auch, dass ein Kontoinhaber kleine Summen von einer großen Zahl von Menschen erhalte.
Die FIU erklärte dazu auf Anfrage, sie habe nach Paragraf 28 Geldwäschegesetz den Auftrag, die Banken für »entsprechende Typologien und Methoden« im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung »zu sensibilisieren«.
Die Hinweise jedoch würden angesichts ihrer Schutzbedürftigkeit ausschließlich den Geldinstituten (und anderen nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Personen) auf einem sicheren Weg verfügbar gemacht.
Aufmerksame Leser haben vielleicht bemerkt, dass die Bank in den Hinweisen der FIU eine Vorgabe sieht. Die FIU selbst spricht lediglich von Sensibilisierung. Auch der Paragraf 28 Geldwäschegesetz sieht nur einen »Austausch« zwischen Banken und FIU über Methoden in der Finanzkriminalität vor. Warum unterscheidet sich hier die Wahrnehmung? Eine Erklärung liefert Paragraf 15 Geldwäschegesetz.
Dort steht, dass »verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen« sind, wenn eine Transaktion »besonders komplex oder ungewöhnlich groß ist« oder »einem ungewöhnlichen Transaktionsmuster folgt«. Konkret verlangt das Gesetz dann von der Bank, die Hintergründe zu recherchieren, um das Geldwäsche-Risiko bemessen zu können, und die Geschäftsbeziehung »einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen«.
Die Einschätzung der FIU zieht also einen Rattenschwanz von Verpflichtungen für die Bank nach sich. Die Bank wird darüber informiert, was der Staat verdächtig findet, und sie wird nervös, wenn ein Kunde in dieses Raster fällt. Sie muss sich nun »plausible Dinge ausdenken, um nachzuweisen, dass sie den erhöhten Pflichten« nachkommt. So hat mir das ein Bankvorstand erklärt. Hier kommt wieder die FATF ins Spiel.
Denn die schreibt, wie sie mir mitteilte, nicht nur Standards, die in die Gesetzgebung einfließen, sondern erstellt auch »Leitlinien, die dem Privatsektor dabei helfen können, die Standards besser zu verstehen«. Wie ich aus der Branche vernommen habe, greifen die Banken auf diese Leitlinien zurück, um ihr Vorgehen zu plausibilisieren. Einen solchen Aufwand macht man sich aber nur dann, wenn man einen Kunden nach Möglichkeit behalten will.
Auf die Frage, ob die FATF Banken empfehle, genauer hinzusehen, wenn eine Vielzahl kleiner Transaktionen auf einem Konto landet, antwortete die Organisation, sie habe eine Leitlinie zum Umgang mit Risiken bei Crowdfunding herausgegeben. Das Papier lenke »die Aufmerksamkeit auf verschiedene Aktivitäten, die einer verstärkten Überwachung bedürfen – darunter auch ein ungewöhnlich hohes Aufkommen von Kleinbetragszahlungen«.
Das mag erklären, weshalb die deutsche FIU dieses Kontonutzungsmuster offenbar im Verdachtskatalog listet. Leider scheint sie in diesem Zuge nicht darauf hinzuweisen, dass Spenden für die Arbeit freier Medien in der Regel unproblematisch und von zunehmender Bedeutung sind.
Die FATF überprüft die Arbeit von Regierungen und setzt nicht kooperative Länder auf den Index. Bulgarien steht zum Beispiel auf der Grauen Liste. Eine deutsche Bank muss deshalb bei Transaktion von und nach Bulgarien mehr Aufwand betreiben und genau hinsehen. 2022 veröffentlichte die FATF den Länderbericht Deutschland.
An einigen Stellen wird auch die Mittelbeschaffung durch Spenden für die kurdische PKK und IS-Gruppen thematisiert. Außerdem heißt es da (Seite 106): »Spendenaktionen für rechtsextreme gewaltbereite Gruppen werden als ein wachsendes Problemfeld eingeschätzt.« Dazu folgt als Beispiel eine kleine Zelle, die sich mit Waffen ausstatten wollte (Seite 111).
Spannend wird es, wo es lediglich um den (entfernten) Verdacht geht, dass eine lose Gruppe von Menschen bereit sein könnte, ihre Ideen mit Gewalt durchzusetzen. Von der FATF lernen wir (Seite 127): »Regionen Westdeutschlands wurden Mitte 2021 von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht.
Im Rahmen der laufenden Beobachtung stellte das Bundesamt für Verfassungsschutz fest, dass Rechtsextremisten die Katastrophe nutzten, um Spendengelder zu sammeln, was Bedenken hinsichtlich potenzieller Terrorismusfinanzierung aufwarf.«
Spendenaktionen im Rahmen der Ahrtal-Katastrophe waren damals in etablierten Medien kritisiert worden. Der HNO-Arzt und Maßnahmenkritiker Bodo Schiffmann soll 700.000 Euro gesammelt haben. Spendenaktionen gab es zudem aus dem Kreise der AfD-Jugendorganisation und der NPD, schreibt der Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Die Zeitschrift Compact rief ebenfalls zur Unterstützung auf.
Ende 2021 stufte der Bundesverfassungsschutz das Medienunternehmen als erwiesen rechtsextremistisch ein. Das vom Innenministerium Mitte 2024 verfügte Verbot wurde kurz später vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben.
Während einer Spendenkampagne für den AfD-Wahlkampf Anfang 2024 kündigte eine Sparkasse der Zeitschrift. Zugang zu Bankdienstleistungen erwirkte das Unternehmen schlussendlich auf dem Gerichtsweg. Die Richter befanden, dass sich auch Compact auf die Grundrechte berufen darf.
Schlussfolgerungen
Je mehr der Staat unliebsame Meinungen auf beiden Seiten des politischen Spektrums mit Extremismus und implizit mit einer Terrorgefahr verknüpft, desto mehr Regierungskritiker werden ihre Konten verlieren.
Das funktioniert schon jetzt: Der Bayerische Rundfunk feierte sich dafür, Paypal zur Sperrung von Konten nicht genannter »Rechtsextremer« bewegt zu haben, deren Namen zum Teil in Verfassungsschutzberichten zu lesen seien. Paragraf 15 Geldwäschegesetz verlangt den Banken viel ab, wenn das Risiko der Terrorismusfinanzierung »bestehen kann«.
Es ist richtig, Terrorszenarien ernstzunehmen, aber es ist eine vorrangige Aufgabe des Staates, die Ausübung von Grundrechten zu schützen. Ein Bankkonto ist heute notwendig, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Bei leserfinanzierten unabhängigen Medien und Journalisten sprechen wir von der unabdingbaren Arbeitsgrundlage und der Voraussetzung zur Wahrnehmung der Pressefreiheit.
Wenn harte Auflagen Banken dahin treiben, Konten zu kündigen oder sie von Anfang an zu versagen, muss der Staat ein Recht auf ein Girokonto zur geschäftlichen Nutzung für Menschen, Unternehmensgesellschaften und sonstige Organisationen einführen.
Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD steht davon allerdings nichts. Stattdessen heißt es lapidar: »Im Hinblick auf die nächste Prüfung der Financial Action Task Force (FATF) werden wir entscheidende Verbesserungen bei der Geldwäschebekämpfung vornehmen.«
Schon 2021 unterwarfen sich die Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP den von Rechts wegen unverbindlichen Vorgaben der internationalen Arbeitsgruppe von Behördenvertretern bedingungslos: »Mögliche Empfehlungen aus der FATF-Deutschlandprüfung werden wir wo nötig zügig in deutsches Recht umsetzen.«
Die führenden Journalisten-Gewerkschaften bleiben still, während regierungskritische Medienschaffende um ihre Existenz bangen. Die Deutsche Journalistenunion (DJU) ließ eine neuerliche Anfrage zu Kontokündigungen unbeantwortet.
Der Deutsche Journalistenverband (DJV) dagegen schrieb, ihm seien neben dem vorgebrachten Fall der Publizistin Gaby Weber keine weiteren betroffenen Journalisten bekannt. Offenbar hat der vormalige DJV-Pressesprecher Hendrik Zörner zum Jahresende auch das Wissen um die Kontokündigungen der Medienunternehmen von Apolut und Manova mit in den Ruhestand genommen. Ich hatte ihn darauf angesprochen und später über zahlreiche weitere Fälle publiziert.
Die neue Pressesprecherin antwortete auf die Frage, ob der DJV politischen Handlungsbedarf sehe, lediglich mit einer Einschätzung der gegenwärtigen Rechtslage: Privatbanken dürfen demnach kündigen, Sparkassen müssen dabei das Gleichbehandlungsgebot berücksichtigen.
Quellen: PublicDomain/norberthaering.de am 25.04.2025