

„Es tut mir leid, daß ich dich töten mußte, kleiner Bruder. Aber ich brauche dein Fleisch, denn meine Kinder hungern. Vergib mir, kleiner Bruder. Ich will deinen Mut, deine Kraft und deine Schönheit ehren – sieh her! Ich hänge dein Geweih an diesen Baum; jedesmal, wenn ich vorbeikomme, werde ich an dich denken und deinem Geist Ehre erweisen. Es tut mir leid, daß ich dich töten mußte; vergib mir, kleiner Bruder. Sieh her, dir zum Gedenken rauche ich die Pfeife, verbrenne ich diesen Tabak.“
Eine Cherokee-Indianerin hat obiges Gedicht 1974 geschrieben. Dieser Jäger, der um Vergebung bittet bei dem Hirsch, den er erlegt hat, ist symbolhaft für die indianische Lebenshaltung. Die ihr innewohnende Ehrfurcht vor allem Leben ist ihr herausragendes Merkmal, das uns weiße Menschen beschämen muß.
Der Santee-Dakota Ohiyesa (1858–1939) sprach: „Im Leben eines Indianers gab es eine Pflicht, deren Erfüllung er nie vergaß – die Pflicht, jeden Tag im Gebet das Ewige und Unsichtbare zu ehren.
Wann immer er auf seiner täglichen Jagd auf ein Bild ehrfurchtgebietender Schönheit stößt – eine Regenbogenbrücke vor einer schwarzen Gewitterwolke über den Bergen; einen weißschäumenden Wasserfall im Herzen einer grünen Schlucht; eine weite Prärie, vom Sonnenuntergang blutrot angestrahlt –, verharrt der rote Jäger einen Augenblick in anbetender Haltung.
Alles, was er tut, hat für ihn eine religiöse Bedeutung. Er spürt den Geist des Schöpfers in der ganzen Natur und glaubt, daß er daraus seine innere Kraft erhält. Er achtet das Unsterbliche im Tier, seinem Bruder, und diese Ehrfurcht führt in oft so weit, daß er den Kopf eines erlegten Tieres mit symbolischer Farbe oder mit Federn schmückt. Dann hält er die gefüllte Pfeife hoch – als Zeichen, daß er auf ehrenhafte Weise den Geist seines Bruders befreit hat, dessen Körper zu töten er gezwungen war, um selber weiterzuleben.“
Für Ohiyesa blieben die Tiere seine kleinen Brüder, auch nachdem der Sioux im Jahre 1890 an der Universität Boston zum Doktor der Medizin promovierte.
Könnten wir nicht auch jene Tierseelen ehren und ‚befreien‘, die einen angstvollen Tod im Schlachthaus und meist auch ein qualvolles Leben hinter sich haben, wenn wir kurz in Dankbarkeit an sie denken und sie segnen, bevor wir ihr Fleisch auf unserem Teller mit der Gabel aufspießen? Wenn wir denn überhaupt noch Fleisch essen wollen.
„Tag für Tag kannst du sehen, wie Farmarbeiter über dieses Land hier reiten,“ erzählte Lame Deer (1900–1974) traurig einem weißen Freund. „An ihrem Sattelhorn hängt ein Sack voll Körner. Wann immer sie einen Präriehundbau sehen, werfen sie eine Handvoll Hafer hinein, wie eine nette kleine alte Frau, die im Park die Tauben füttert. Nur, daß der Hafer für die Präriehunde mit Strychnin vergiftet ist. Wie es einem Präriehund ergeht, nachdem er diese Körner gefressen hat, das ist wahrlich kein schöner Anblick. (Lakota-Prophezeiung: Der heilige weiße Büffel ist zurückgekehrt (Video))
Die Präriehunde müssen sterben, weil sie Gras fressen. Tausend Präriehunde fressen im Jahr soviel Gras wie eine Kuh. Wenn also der Farmer eine so große Anzahl von ihnen tötet, kann er sich eine Kuh mehr halten und ein bißchen mehr verdienen. (Prophezeihungen der Indianer Nordamerikas: Das Zeitalter des Erwachens)
Für den Weißen ist jeder Grashalm und jede Wasserquelle mit einem Preisschild versehen. Damit fängt es an. Und sieh nur, wie es weitergeht! Luchs und Koyote, die sich bisher von Präriehunden ernährten, müssen jetzt ein Lamm, das sich verlaufen hat, oder ein krankes Kälblein schlagen. Der Farmer ruft daher einen Mann von der Schädlingsbekämpfung und gibt ihm den Auftrag, diese Tiere zu töten.
Der Mann kommt, schießt ein paar Kaninchen und legt sie als Köder aus, nachdem er ein Stückchen Holz hineingesteckt hat. Das Holzstück enthält eine Sprengladung, die Zyankali in das Maul des Kojoten schießt, der an dem Köder zerrt.
So wird die Prärie ein totes Land, in dem es kein Leben mehr gibt – keine Präriehunde, keine Dachse, keine Füchse, keine Kojoten. Auch die großen Raubvögel ernährten sich von den Präriehunden; heute kannst du kaum noch einen Adler sehen. Der weißköpfige Seeadler ist das Wappentier der Vereinigten Staaten. Sein Bild schmückt euer Geld, aber eure Geldgier rottet ihn aus. Wenn ein Volk beginnt, seine eigenen Symbole zu vernichten, dann ist es schlecht um dieses Volk bestellt.“
Lame Deer war ein Dakota (Sioux) und die Prärie war sein Zuhause. Wie müssen ihn seine Worte geschmerzt haben.
An jedem Tag das Ewige zu ehren, ist für den Indianer eine innere Pflicht. Das ist der geistige Nährboden, auf dem wunderbare, natürliche Heilmittel hervorgebracht werden konnten. Denn die Natur schenkt alles, was man braucht, wenn es in Dankbarkeit empfangen wird. Ohne Dankbarkeit kann niemals wahres Glück gedeihen. Sie ist die Schwester der Ehrfurcht. Die Indianer besaßen beides im Übermaß; selbst die in unseren Augen so blutrünstig dargestellten Irokesen. Sie beteten vor jeder Ratsversammlung:
„Wir danken unserer Mutter, der Erde, die uns ernährt. Wir danken den Flüssen und Bächen, die uns ihr Wasser geben. Wir danken den Kräutern, die uns ihre heilenden Kräfte schenken. Wir danken dem Mais und seinen Geschwistern, der Bohne und dem Kürbis, die uns am Leben erhalten. Wir danken den Büschen und Bäumen, die uns ihre Früchte spenden.
Wir danken dem Wind, der die Luft bewegt und Krankheiten vertreibt. Wir danken dem Mond und den Sternen, die uns mit ihrem Licht leuchten, wenn die Sonne untergegangen ist. Wir danken unserem Großvater Hé-no (Regengeist), der uns, seine Enkelkinder, schützt und uns seinen Regen schenkt. Wir danken der Sonne, die freundlich auf die Erde herabschaut. Vor allem aber danken wir dem Großen Geist, der alle Güte in sich vereint und alles zum Wohl seiner Kinder lenkt.“
Ernest Benedict, ein Mohawk, umschrieb das indianische Lebensgefühl mit wenigen Worten: „Unser Volk weiß, daß der Natur eine wichtige Rolle zukommt, denn die Natur kann ohne den Menschen bestehen, der Mensch aber nicht ohne sie. Hegten die Weißen eine ähnliche Dankbarkeit für die Geschenke der Schöpfung, so wäre die Erde ein besserer Platz zum Leben; denn niemand vernichtet, was er verehrt und liebt.“
Weil die Indianer die Erde ehrten, liebte die Erde sie und schenkte ihnen alles, was sie zum Leben brauchten. Gleich den Essenern brachten sie selbst in kargen Einöden noch Nahrungsmittel hervor, wo die weißen Siedler längst kapituliert hatten. Das erregte oft den Neid der weißen Eroberer. So lebten beispielsweise die Cherokee ursprünglich als Ackerbauern im Südosten der Vereinigten Staaten, wo sie in größeren Siedlungen wohnten und eine demokratische Regierungsform hatten.
Ihr Wohlstand zog die Mißgunst weißer Siedler auf sich und die Cherokee wurden gewaltsam nach Oklahoma übersiedelt, in ein dürres, unfruchtbares Gebiet. Als die Indianer auch dieses Land fruchtbar gemacht hatten, wurde es ihnen wieder weggenommen.
Wir vergessen leicht, daß die Indianer beileibe nicht nur umherwandernde Sippenverbände waren, wie wir sie aus den Wildwestfilmen her kennen. Schon viele tausend Jahre vor der Eroberung Amerikas durch die Weißen existierten indianische Reiche, deren Kultur oft so herausragend war, daß wir uns nach ihrer vollständigen Zerstörung nicht mehr vorstellen können, wie hochstehend diese Menschen wirklich waren. So weiß man heute von den Inka-, Maya- und Aztekenreichen kaum mehr als deren Namen.
Nicht nur die alten Indianerreiche hatten eine gut funktionierende Staats- und Gesellschaftsordnung, sondern auch die kleineren Sippenverbände der nordamerikanischen Indianer. So waren beispielsweise die Frauen schon immer geachtet und mit großen Rechten ausgestattet. Nicht nur Männer, sondern auch Indianerinnen konnten Medizinfrauen werden und manchmal kam es sogar vor, daß eine Frau zum Häuptling gemacht wurde.
Die Indianer kannten nicht nur Kriegshäuptlinge (‚Generäle‘), sondern auch Friedenshäuptlinge, die sogenannten ‚Sachems‘. Sie waren die abgeordneten Richter eines jeden Stammes, die für Recht, Demokratie und Ordnung zu sorgen hatten. Sie wurden ausschließlich von den Frauen gewählt.
Die Indianer waren nämlich überhaupt nicht so kriegslüstern, wie wir sie lange sahen. Ein Spruch der Mohawk (Irokesen) lautet: „Friede ist nicht nur das Gegenteil von Krieg, nicht nur der Zeitraum zwischen zwei Kriegen – Friede ist mehr. Friede ist das Gesetz menschlichen Lebens. Friede ist dann, wenn wir recht handeln und wenn zwischen jedem einzelnen Menschen und jedem Volk Gerechtigkeit herrscht.“
Es waren die Irokesen, die eine Indianer-Nation entwarfen, deren Beispiel sogar die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika beeinflussen sollte. Dieser Irokesenstaat ist untrennbar mit dem Namen einer sagenhaften Gestalt verbunden: Hiawatha, dem Boten des Friedens. Wann genau er gelebt hat, weiß man nicht mit Sicherheit, doch Historiker setzen ihn ins 15. Jahrhundert, etwa 50 Jahre, bevor Christoph Kolumbus den neuen Kontinent entdeckte.
Die Irokesen lebten im heutigen Staat New York, aufgesplittert in fünf Stämme: die Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida und die Mohawk. Viele Irokesen behaupten, Hiawatha sei in einem Onondaga Dorf geboren worden, doch andere Quellen sehen ihn als ein Kind der Mohawk.
Hiawatha – diesen Namen erhielt er erst später in seinem Leben – wuchs in einem Langhaus auf, der für die Irokesen typischen Behausung. Eine Siedlung bestand aus etwa zehn Langhäusern, in denen jeweils ungefähr zehn miteinander verwandte Familien lebten, nur durch Felle und Tierhäute voneinander abgetrennt. Diese Wohnform war für die Irokesen so wichtig, daß sie sich selbst ‚Hodenosaunee‘ nannten, das ‚Volk der Langhäuser‘.
Da die Irokesen der Überzeugung waren, daß Frauen ein besseres Unterscheidungsvermögen hätten als Männer (das Weibliche repräsentiert schließlich die Weisheit), war Hiawathas Mutter höchstwahrscheinlich auch immer dabei, wenn wichtige Entscheidungen gefällt wurden. Die älteste Frau in einem Langhaus war für alle verantwortlich, die darin lebten. Diese Frauen wählten die Führer, ‚Chiefs‘ genannt, und befahlen ihnen, was sie an den Stammestreffen zu sagen hätten. Außerdem entschieden sie, wann die Männer in den Krieg zogen. Ein richtiges Matriarchat also.
Die Männer waren für die Jagd verantwortlich und in Kriegszeiten natürlich auch für das Kämpfen. Die Stammesältesten genossen besonders hohes Ansehen, denn sie lehrten den Kindern die alten Überlieferungen und Traditionen des Stammes. Die Alten brachten den Kindern beispielsweise bei, daß man immer zuerst den Geist des Flusses anrufen mußte, wenn man ihn überqueren wollte oder den Geist des Waldes, bevor man diesen betrat.
Das sind keine Spleens eines ‚dummen‘ Naturvolkes. Im Gegenteil. Wir Weißen hätten gut daran getan, es ihnen gleich zu tun: So schrieb ein weiser hellsichtiger Philosoph vor noch nicht allzulanger Zeit, daß der weltberühmte Yosemite-Nationalpark in Kalifornien von den mächtigen Devas verlassen worden sei. Die riesigen, jahrhundertealten Bäume seien nicht länger beseelt. Warum? Weil es diesen strahlenden Naturwesen zu laut geworden sei; sie hätten genug gehabt von diesen Horden lärmender und achtloser Touristen, die beständig ihre Stille entweihten.
Die Irokesen-Kinder wurden aber auch gelehrt, was es heißt, ‚den rechten Pfad zu nehmen‘: Freunden, Verwandten und Fremden mit Freundlichkeit zu begegnen, aber auch Feinde mit Härte zu verfolgen. Denn die Irokesen kannten das Gesetz der Blutrache. Wenn jemand getötet wurde, so mußten seine männlichen Angehörigen den Mörder, oder irgendein Mitglied seiner Sippe ebenfalls töten. Doch diese seit Generationen dauernde Blutrache hatte die fünf Irokesenstämme bitter entzweit.
Das war die Welt, die Hiawatha zu ändern gekommen war. Er wurde bald ein Führer seines Volkes, vielleicht sogar ein ‚Chief‘, denn er war ein hervorragender Redner. Doch was er sagte, schockierte viele. Zu einem Volk, das oft im Krieg lebte, sprach er von Frieden. Zu einem Volk, das oft nur für die Rache zu leben schien, sprach er von Freundschaft unter den Stämmen.
Unter den Onondaga-Indianern lebte aber auch Ododarhoh, ein Mann von teuflischer Bosheit. Seine Gedanken seien so böse gewesen, erzählten sich die Irokesen, daß auf seinem Kopf Schlangen wuchsen. Er lebte für sich allein und tötete viele Menschen, manchmal aus dem einzigen Grund, weil sie ihm zu laut waren.
Eines Tages, vermutlich aus Gründen der Blutrache, massakrierte Ododarhoh Hiawathas Frau und Kinder. Hiawathas Schmerz war so groß, daß ihn niemand trösten konnte. Alle erwarteten, daß er jetzt Ododarhoh töten würde, wie es der Blutrache entsprach. Doch Hiawatha war des Tötens müde und verließ stattdessen seinen Stamm, um in der Stille des Waldes zu leben.
Keiner weiß, wie lange er so lebte, traurig und von den Menschen gemieden. Doch eines Tages stand ein Mann vor Hiawathas Hütte. Sein Name war Degandawida, doch die Irokesen nannten ihn ‚den Friedensstifter‘. Er war ein Sohn der Huronen, eines weiter nördlich lebenden Stammes, der mit den Irokesen verwandt war. Seit einiger Zeit wanderte er im Volk der Irokesen umher und sprach davon, daß die fünf Irokesenstämme ihren Zwist begraben sollten, um sich in Frieden zu einer Nation zu vereinen. Doch sie wollten nicht auf ihn hören, denn er war ein Fremder, der nicht einmal richtig ihre Sprache beherrschte. Hiawatha horchte auf. Was dieser Mann da stammelte, entsprach auch seinem Herzen.
Sie entwarfen einen Plan, wie sich die fünf Stämme vereinigen und eine gemeinsame Regierung bilden könnten, die interne Streitereien regeln und die Kriegspolitik bestimmen sollte. Die Blutrache mußte aufgegeben werden, stattdessen sollte ein Mörder der Familie des Opfers eine hohe Buße bezahlen.
So verließ Hiawatha seine einsame Klause und reiste mit dem ‚Friedensstifter‘ von Dorf zu Dorf. Jetzt hörten ihm die Menschen zu. Nicht nur, weil er ein guter Redner war. Wenn ein Mann, dessen Frau und Kinder ermordet wurden, auf die Rache verzichtete, dann mußte etwas Wahres in seinen Worten sein.
Die beiden Männer konnten fast alle Irokesen für den Gedanken eines gemeinsamen Staates gewinnen. Doch die Ogonanda wollten sich dem Bündnis nicht anschließen, weil Ododarhoh, Hiawathas großer Feind, sich dagegen stellte. Es kostete Hiawatha viel Überwindung, mit dem Mörder seiner Familie sprechen zu müssen, doch er wusste, wenn er es nicht tat, wäre die Vision eines Irokesenstaates zunichte gemacht.
Also machte er sich mit dem Friedensstifter auf, ihn zu suchen. Sie fanden Ododarhoh in einem Sumpf. Hiawatha besänftigte ihn mit Gesang, dann sprach er zu ihm von Frieden und der Einheit aller Irokesen. Ododarhoh starrte zu Boden, während die Schlangen auf seinem Kopf zischten. Lange saß er still da, bis er endlich
den Kopf hob und sagte, er sei bereit, sein Leben zu ändern und sich Hiawathas Lehren zu unterziehen.
Darauf soll ihm Hiawatha die Schlangen aus dem Haar gekämmt haben. Die Irokesen sagen, daß er so zu seinem Namen gekommen sei, denn Hiawatha bedeutet ‚Jener, der kämmt‘.
So führte Ododarhoh auch die Onondagas in die Irokesen-Union und für das ‚Volk der Langhäuser‘ brach eine neue Zeit an. Man wählte eine Hauptstadt und die Frauen wählten zehn Chiefs von jedem Stamm als Abgeordnete in die Nationalregierung, den ‚Großen Rat‘. Er trat periodisch zusammen und das Abzeichen seiner Mitglieder war ein Hirschgeweih.
Hiawatha und der Friedensstifter schufen eine Verfassung und gaben den Irokesen Gesetze. Zu jener Zeit habe der ‚Friedensstifter‘ den Kieferbaum als Symbol des Friedens zwischen den fünf Irokesenstämmen gewählt. Für ‚Frieden‘ benutzten sie dasselbe Wort wie für ‚Gesetz‘, dieselbe Wortwurzel taucht auch in den Bezeichnungen für die Begriffe ‚edel, vornehm‘ und ‚gut‘ auf.
Ein weitverbreiteter Glaube sagt, Hiawatha und der ‚Friedensstifter‘ seien – da ihr Werk vollbracht war – mit einem Kanu auf die großen Seen und da in die untergehende Sonne gefahren. Es wird erzählt, die beiden hätten einen neuen Weg in den Himmel gefunden, den Weg des Friedensstifters.
Dank ihrem Bündnis wurden die Irokesen zum machtvollsten Indianervolk nördlich von Mexiko. Dieser Irokesenstaat blühte während drei Jahrhunderten, bis ihm der amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775–1783) ein Ende setzte: Die Indianer verbündeten sich mit den Briten, weil sie fürchteten, daß ihnen die Amerikaner ihr Land wegnehmen würden; was dann auch bald geschah.
Doch noch heute senden einige der 80’000 verbliebenen Irokesen, die in Kanada, New York und Wisconsin leben, ihre Delegierten zum Großen Rat, der noch immer in ihrer alten Hauptstadt in der Nähe von Syracuse, New York zusammenkommt. Sie halten Hiawathas Andenken in Ehren, der nicht nur ihnen eine Verfassung gab, sondern dem ganzen amerikanischen Volk. Denn einige Gründungsväter der Vereinigten Staaten kannten die Verfassung der Irokesen und nahmen sie zum Vorbild, als 1787 die amerikanische Verfassung geschaffen wurde.
Hiawatha, dieser große indianische Lehrer, soll die Menschen auch heute noch lehren und ihnen die kosmischen Gesetze näher bringen. Allerdings nennt er sich jetzt ‚White Eagle‘. Viele Bücher sind erschienen, in denen er seiner Schülerin Grace Cooke aus der unsichtbaren Welt Weisheit und Belehrung übermittelt hat. White Eagle (Weißer Adler = ‚geistiger Lehrer‘) hat zwar nie von sich behauptet, er sei Hiawatha gewesen (er verabscheut Personenkult), doch gab er zu, in seiner letzten Inkarnation ein Irokesenhäuptling gewesen zu sein. Aus verschiedenen Äußerungen heraus ist sich Grace Cooke jedoch fast sicher, daß er Hiawatha selbst war (er war vor 10’000 Jahren auch ein Maya-König in Peru).
White Eagle sagte über seine Rasse: „Eines lag den Indianern sehr am Herzen. Ihr würdet es Moral oder Ethik nennen. Sie waren ehrenhaft, ihr Wort galt, und wenn sie von anderen Rassen gegenteilige Erfahrungen machten, waren sie zutiefst schockiert.
Sie besaßen Charakterstärke, waren zielgerichtet, entschlossen und loyal. Das Niveau ihrer Zivilcourage und ihrer Ethik war viel höher als die des weißen Mannes es je war und ist. Trotzdem glaubt der weiße Mann, daß die Rothäute grausam und wild waren. Dies aber wurden sie erst, als man sie betrog, erst als der weiße Mann sie durch Grausamkeit grausam machte.“
So heißt es denn auch in der Verfassung der Irokesen: „O Häuptlinge! Tragt keinen Zorn im Herzen und hegt gegen niemanden Groll. Denkt nicht immer nur an euch selber und an eure eigene Generation. Vergeßt nicht, daß nach euch noch viele Generationen kommen werden, denkt an eure Enkelkinder und an jene, die noch nicht geboren sind und deren Gesichter noch im Schoß der Erde verborgen liegen.“
Verantwortung gegenüber Kindern. Das war ein zentraler Zug im Wesen indianischer Kultur. So sagte Luther Standing Bear (1868–1939) von seinem Volk: „Im Stamm der Lakota war jeder gern bereit, Kinder zu betreuen. Ein Kind gehörte nicht nur einer bestimmten Familie an, sondern der großen Gemeinschaft der Sippe; sobald es gehen konnte, war es im ganzen Lager daheim, denn jeder fühlte sich als sein Verwandter.
Meine Mutter erzählte mir, daß ich als Kind oft von Zelt zu Zelt getragen wurde und sie mich an manchen Tagen nur hie und da zu Gesicht bekam. Niemals sprachen meine Eltern oder Verwandten ein unfreundliches Wort zu mir, und niemals schalten sie mich, wenn ich etwas falsch gemacht hatte. Ein Kind zu schlagen, war für einen Lakota eine unvorstellbare Grausamkeit.“
Solcher Art war die Haltung der stolzen Sioux-Krieger. Lassen wir nochmals Luther Standing Bear zu Wort kommen, ein Dakota (so nannten sich die Sioux selber), der von weißen Lehrern mit Gewalt zu einem ‚zivilisierten Amerikaner‘ gemacht wurde, und der als Kind nicht einmal mehr seine eigene Sprache sprechen durfte: „Die alten Dakota waren weise. Sie wußten, daß das Herz eines Menschen, der sich der Natur entfremdet, hart wird; sie wußten, daß mangelnde Ehrfurcht vor allem Lebendigen und allem, was da wächst, bald auch die Ehrfurcht vor dem Menschen absterben läßt. Deshalb war der Einfluß der Natur, die den jungen Menschen feinfühlig machte, ein wichtiger Bestandteil ihrer Erziehung.“
Die Indianer waren Naturmenschen im besten Sinne. Die Erde war weit mehr für sie als bloße Erde. Berühmt geworden sind die Worte des Shawnee-Häuptlings Tecumseh bei seinem Treffen mit General William Harrison (1812). Dieser hatte Tecumseh einen Stuhl zum Sitzen angeboten, was der Dolmetscher mit den Worten ‚Dein Vater bittet dich, einen Stuhl zu nehmen‘ übersetzte. Stolz entgegnete der Häuptling: „Mein Vater? Mein Vater ist die Sonne und die Erde ist meine Mutter. An ihrer Brust will ich sitzen.“ Sprach’s, und setzte sich demonstrativ auf den Erdboden, wie es der indianischen Tradition entsprach.
Auch Sitting Bull (1834–1890), der wohl berühmteste aller Indianer, kritisierte in einer 1866 gehaltenen Rede die Überheblichkeit der Weißen. „Seht meine Brüder, der Frühling ist da,“ sprach der Medizinmann und Häuptling der Sioux zu seinem Volk, „die Sonne hat die Erde in Liebe umarmt. Bald werden wir die Kinder dieser liebenden Verbindung sehen. Jedes Samenkorn und jedes Tier ist erwacht. Dieselbe große Kraft hat auch uns Leben gegeben. Darum haben auch unsere Mitmenschen und unsere Freunde, das gleiche Recht wie wir, auf dieser Erde zu wohnen.
Doch hört, meine Brüder! Jetzt haben wir es mit einer anderen Art von Menschen zu tun. Sie waren wenige und schwach. Jetzt aber sind sie viele und stark. Es ist kaum zu glauben, aber sie wollen die Erde umpflügen. Ihre Krankheit ist die Habgier. Sie sagen, die Erde, also unsere Mutter, gehöre ihnen. Sie zwingen unsere Mutter, zur Unzeit Leben zu gebären. Und wenn sie keine Frucht mehr trägt, geben sie ihr eine Medizin, damit sie wiederum gebiert. Was sie tun, ist nicht heilig.“
Die Indianer aber liebten ihre Mutter Erde über alles und hatten keine Furcht vor ihr: „Für uns Indianer war das weite Grasland, die Prärie, mit ihren schönen, wie Meereswogen dahinrollenden Hügeln, mit ihren sich schlängelnden Flüssen und den dicht verwachsenen Ufern keine ‚Wildnis‘. Nur der Weiße empfand die unberührte Natur als ‚Wildnis‘, verseucht mit ‚wilden‘ Tieren und ‚wilden‘ Menschen.
Wir Indianer lebten ohne Furcht in diesem Land. Die Erde gab uns im Überfluß, und in allem sahen wir den Segen des Großen Geistes. Erst als die bärtigen Männer aus dem Osten kamen und uns und die Familien, die wir liebten, mit Haß und Wut verfolgten, wurde dieses Land für uns zu einer ‚Wildnis‘. Als die Tiere vor den Weißen aus den Wäldern zu fliehen begannen, fing für uns der ‚Wilde Westen‘ an.“ (Luther Standing Bear).
Früher, als der Westen noch friedfertig war, störte nichts die Kommunikation von Mutter Erde mit ihren Kindern. Die Indianer sprachen mit den Tieren und hörten sogar auf die Pflanzen: „Weißt du, daß die Bäume reden? Ja, sie reden. Sie sprechen miteinander, und sie sprechen zu dir, wenn du zuhörst. Aber die weißen Menschen hören nicht zu. Sie haben es nie der Mühe wert gefunden, uns Indianer anzuhören, und ich fürchte, sie werden auch auf die anderen Stimmen in der Natur nicht hören. Ich selbst habe viel von den Bäumen erfahren: manchmal etwas über das Wetter, manchmal über Tiere, manchmal über den Großen Geist.“ (Tatanga Mani, gestorben 1967, Häuptling der Stoney-Indianer).
Seit Jahrtausenden hatten die Indianer kranke oder verletzte Tiere beobachtet; wie sie sich verhielten und vor allem, welche Pflanzen sie fraßen, um sich zu heilen. Dieses Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Manchmal haben sich sogar weiße Wissenschaftler von den ‚primitiven‘ Eingeborenen inspirieren lassen: So behandeln die Indianer Südamerikas Fieber und Malaria seit Jahrhunderten mit einem Tee aus der Rinde des Cinchona-Baumes.
Analysen zeigten, daß diese Rinde sehr viel Chinin enthält. Die Indianer Nordamerikas heilten Kopfschmerzen und viele andere Beschwerden mit einem Sud aus der Rinde der weißen Weide. Heute erhalten wir synthetisch hergestellte Weidenrinde in jeder Apotheke unter dem Namen ‚Aspirin‘.
Die Dakota hatten zudem mit den zerstoßenen Wurzeln des Stinkkohl ein Mittel gefunden, das Asthma linderte, und die Kiowa behandelten Schuppen mit Seifenkraut. Gegen Übelkeit tranken die Cheyenne einen Abguß von wilder Minze, während die Cree winzige Fichtenzapfen kauten, um Halsschmerzen zu lindern. Immerhin nahm die U.S. Pharmacopeia 170 indianische Heilmittel wegen ihres medizinischen Wertes offiziell in ihre Listen auf.
Die indianischen Medizinmänner erhielten ihr großes Wissen um die Heilwirkung verschiedener Kräuter auch durch Visionen und Eingebungen, sie waren aber auch hervorragende Beobachter: „Ich bin ein wicasa wakan, ein Medizinmann.
Ein wicasa wakan muß viel und oft mit sich allein sein. Er will weg von der Menge, weg von den kleinen alltäglichen Dingen. Er liebt es, zu meditieren, sich an einen Baum oder an einen Felsen zu lehnen und zu fühlen, wie sich die Erde unter ihm bewegt und wie über ihm das Gewicht des weiten flammenden Himmels lastet. Auf diese Weise lernt er zu verstehen. Er schließt die Augen und beginnt klarer zu sehen. Was du mit geschlossenen Augen siehst, das zählt.
Der wicasa wakan liebt die Stille, er hüllt sich in sie ein wie in eine Decke – eine Stille, die nicht schweigt, die ihn mit ihrer donnergleichen Stimme vieles lehrt. Solch ein Mann liebt es, an einem Ort zu sein, wo er nur das Summen der Insekten hört. Er sitzt, das Gesicht gegen Westen, und bittet um Beistand. Er redet mit den Pflanzen, und sie antworten ihm. Er lauscht den Stimmen der wama kaskan – der Tiere.
Er wird einer von ihnen. Von allen Lebewesen fließt etwas in ihn ein, und auch von ihm strömt etwas aus. Ich weiß nicht, was und wie, aber es ist so. Ich habe es erlebt (vgl. Pranha-Artikel Seite 44). Ein Medizinmann muß der Erde angehören, muß die Natur lesen können wie ein weißer Mann ein Buch.“
So sprach Lame Deer, Medizinmann der Sioux. Doch ‚Medizinmann‘ ist eine schlechte Übersetzung des Titels wicasa wakan. Er bedeutet Priester, Seher, Arzt, geistiger Führer – kurz, ein heiliger Mann.
Solch heilige Menschen hat auch Martina Kässner Fischer kennengelernt, als sie vor zwei Jahren mit ihrem Mann Roland Romain Fischer und ihrer „Ente“ (Citroën 2CV) quer durch Kanada fuhr. In ihrem Reisebericht schreibt Martina Kässner Fischer: „In Wanuskewin bei Saskatoon ermöglichte mir der Häuptling der Cree nicht nur Gespräche mit den ‚Elders‘ (die alten weisen Männer und Frauen, die dem Geheimbund der ‚Spiritual Healers‘ angehören), sondern auch eine vertiefte Einführung in die Heilkräuter- und Pflanzenwelt durch eine erfahrene Schamanin, die zwar Heilerin ist, aber auch westliche Schulmedizin studierte. Ihre Urgroßmutter (eine Cree) und Großmutter (eine Ojibwa) unterrichteten sie jedoch bereits als Kind in Naturheilkunde.
In bescheidener Art und Weise erklärt mir Weiße Schwalbe: ‚Für mich ist ein Mensch kein Patient, sondern ein hilfesuchendes spirituelles Wesen. Meine Behandlung beginnt vor Sonnenaufgang mit dem Abfragen des Medizinrades. Was stört bei diesem Geistwesen die Harmonie zwischen den irdischen und kosmischen Elementen? Dann rufe ich die hohen Meister zu Hilfe und bitte sie in der Stille um die Eingebung der richtigen Rezeptur.
Was benötigt dieses Geistwesen von den Elementen der Mutter (Erde) und vom Vater, den kosmischen Energien? Nach Sonnenaufgang verabschiede ich meinen Gast und vereinbare den nächsten Behandlungstermin. Danach wecke ich meine Kinder und nach dem Frühstück gehen wir in die Natur und finden (nicht suchen!, die Red.) die edlen Kräuter, Pflanzen, Rinden und Wurzeln, die ich aber erst nach Sonnenuntergang zu einer gehaltvollen Essenz verarbeite.‘
Auf meine Frage, weshalb sie so großen Erfolg habe, antwortet sie schlicht: ‚Nichts kann der Kraft einer uneingeschränkten Liebe widerstehen. Auch keine Krankheit, die der Mensch nicht wirklich haben möchte. Manitou läßt in seiner großen Liebe für jedes Leiden ein Kräutlein wachsen.‘
Die Frage nach ihren Honoraren erübrigt sich. Der Häuptling ihrer Sippe, John Smith ‚Big Bear‘ erklärte mir stolz: ‚Weiße Schwalbe verlangt kein Geld; sie bekommt es als Geschenk reichlich. Aber erst nach wieder hergestellter Gesundheit!‘ Großer Bär erlebte zwar einen Schlaganfall und sitzt im Rollstuhl, doch noch immer kann er von den alten Zeiten erzählen. Sollte man daher nicht Manitou (Gott) und Weiße Schwalbe (Kanal zum weißen Licht) redlich dafür danken?“, schreibt Martina Kässner Fischer.
Diese hohe Ethik der indianischen Heiler (auch was das Geldverdienen betrifft) würde unseren Ärzten ebenfalls gut anstehen – und die explosionsartig steigenden Gesundheitskosten senken helfen. Wer bei den Indianern ein Medizinmann werden will, muß höchste geistige und moralische Anforderungen erfüllen. Nehmen wir das Beispiel der Ojibwa, die im nördlichen Ontario leben. Ihre Kenntnisse über die Wirkung von Heilkräutern und die Manitous, die übernatürlichen Kräfte, war herausragend unter allen Indianern Amerikas. Deshalb haben die Ojibwa den Großen Ärztebund der Midewiwan.
Der Weg eines Mitglieds der Midewiwan war lang und hart. Ein Aspirant, der nur von einem Medizinmann ausgewählt werden konnte, muß bei diesem Medizinmann zuerst eine Lehrzeit absolvieren, wo er in die Geheimnisse der Heilkräuter eingeweiht wurde und in die Mythen und Riten, welche die Manitou-Kräfte beschwören können. Danach folgte ein viele Tage dauernder Initiations-Ritus, wo der Novize seine Fähigkeiten unter Beweis stellen mußte. Erst danach wurde ihm erlaubt, seine Heilkünste auch anzuwenden.
Doch diese erste Einweihung war erst der Anfang. Es gab vier Grade von Medizinmännern, von denen jeder eine zusätzliche Lehrzeit und Initiationen erforderte. Nur wenige bestanden die Prüfungen zu den höchsten Graden, die sie mit einem unendlichen Heilungswissen bedachten. Um den vierten Grad der Meisterschaft zu erreichen, brauchte man fast das ganze Leben.
Midewiwan heißt wörtlich übersetzt die ‚Gutherzigen‘. Welch höheren Dienst kann es für ein gutes Herz geben, als leidenden Menschen zu helfen?
In den Augen der Ojibwas ist Krankheit nichts anderes als eine Unreinheit in Körper und Geist. Ein unreiner Zustand bringt einen aus dem Gleichklang mit dem Großen Geist, der alles Leben ‚informiert‘. Heilung ist also ein Reinigungsprozeß, der Körper und Seele mit einbezieht. Die Medizinmänner trachten bei ihren Heilanstrengungen also immer danach, den Kranken wieder zurück in eine Balance mit dem Großen Geist zu bringen (vgl. ZeitenSchrift 7, S. 37, Novel-Food).
In Harmonie mit dem Großen Geist zu sein bedeutete für die Indianer aber auch ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Der Navajo Jimmie C. Begay schrieb vor wenigen Jahren in einer Indianerzeitung: „Wenn wir der Erde etwas wegnehmen, müssen wir ihr auch etwas zurückgeben. Wir und die Erde sollten gleichberechtigte Partner sein. Was wir der Erde zurückgeben, kann etwas so Einfaches – und zugleich so Schwieriges – wie Respekt sein.
Die Suche nach Öl, Kohle und Uran hat der Erde bereits großen Schaden zugefügt, aber noch kann dieser Schaden wiedergutgemacht werden – wenn wir es wollen. Beim Abbau von Bodenschätzen werden Pflanzen vernichtet. Es wäre recht und billig, der Erde Samen und Schößlinge anzubieten und dadurch wieder zu ersetzen, was wir zerstört haben. Eines müssen wir lernen: Wir können nicht immer nur nehmen, ohne selber etwas zu geben. Und wir müssen unserer Mutter, der Erde, immer so viel geben, wie wir ihr weggenommen haben.“
Da für die Indianer alles eine Frage des Gleichgewichts ist, kannten sie auch keine Begriffe für ‚Krankheit‘. Für sie gab es nur ‚Besetzungen‘, die einen aus der Harmonie mit der Natur rissen. Solche ‚Besetzungen‘ kann man in einem Schwitz-Zelt voll glühender Steine herausschwitzen. Doch das sei meist eine schmerzhafte Prozedur, zitiert Martina Kässner Fischer den Indianer Barry Sparvier, genannt ‚Bison’s Spirit‘. „Unser Medizinmann hat mit seinem Zaubertrank innerhalb unserer Familie schon vielen das Leben gerettet.“
Bevor die Pflanzen für solche Heiligen Tränke geerntet werden, das ist meist im Spätsommer, sprechen die Medizinmänner folgendes Gebet: „Deinen Geist und meinen Geist vereinige zu einem Geist des Heilens; du gabst die äußere Schönheit, nun bitten wir dich auch um die Gabe des inneren Wohlbefindens.“
Die Ojibwa glauben, daß in allen Pflanzen verkörperte Wesen wohnen; daß jede Pflanze ihren einzigartigen Seelengeist hat, eine belebende Substanz, die ihrer physischen Form Wachstum und Heilkräfte verleiht. Zudem haben die Pflanzen noch eine viel wunderbarere Kraft: es ist die Fähigkeit, sich mit anderen Pflanzen zu einem einzigen Geist zu vereinen, der um ein Vielfaches stärker ist als das Wesen einer einzelnen Pflanze. Es war dieser ‚vereinigte‘ Geist, der die Kräutermedizin der Indianer mit solch gewaltiger Heilkraft ausstattete.
Die Erklärung für dieses Phänomen liegt im Gesetz der Potenzierung: Kommen verschiedene Qualitäten in göttlicher Harmonie zusammen, so summiert sich ihre Wirkung nicht nur, sondern sie potenziert sich. Man sagt dazu auch: ‚Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile‘.
Djwhal Khul, der große tibetanische Meister, sagte gar, Bruderschaft sei längst nicht nur eine spirituelle Qualität, wie wir meinen, sondern eines der fundamentalsten Prinzipien der Natur.
Das Gesetz der Bruderschaft. Wer könnte es uns besser lehren als die Indianer, die Tiere, Pflanzen, Steine und Wasser ihre Geschwister nannten. Was es dazu braucht, soll uns Don C. Talayesva, ein Sonnenhäuptling der Hopi-Indianer, in seinen eigenen Worten sagen: „Ich hatte viele englische Wörter gelernt und konnte einen Teil der Zehn Gebote aufsagen. Ich wusste, wie man in einem Bett schläft, zu Jesus betet, sich kämmt, mit Messer und Gabel ißt und wie man die Toilette benutzt. Ebenso hatte ich gelernt, daß der Mensch mit dem Kopf denkt und nicht mit dem Herzen.“
Quellen: PublicDomain/zeitenschrift.com am 11.01.2024



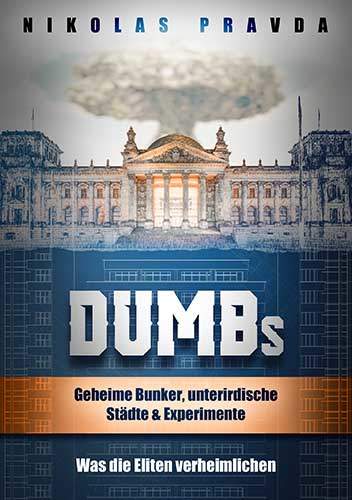







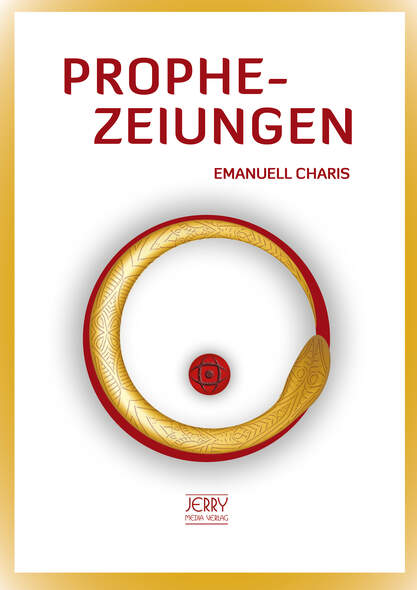

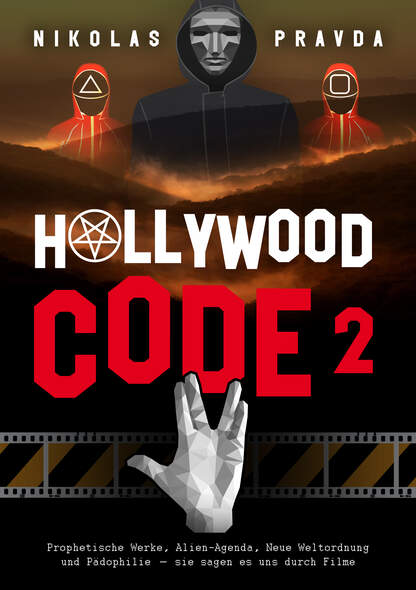














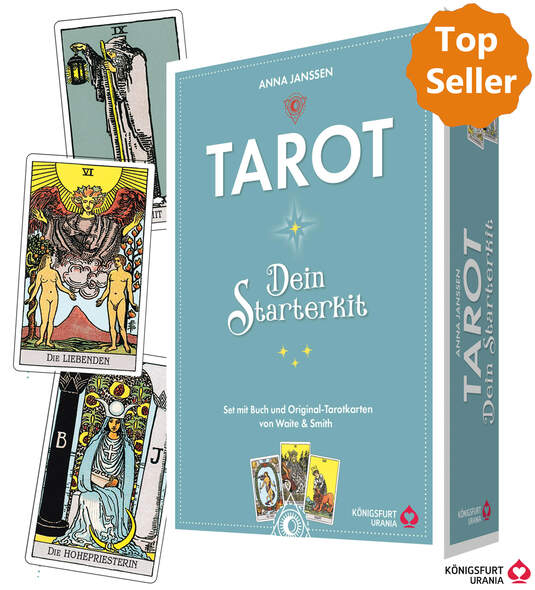

„In diesem Zeitalter wird die Menschheit leichter Zugang zu spirituellen Praktiken und zur Wahrheit finden. Alle bösen Mächte, die die Menschen in Täuschung und Lüge gehalten haben, werden die Erde für immer verlassen. Doch ganz so schnell wird sich nach Worten Risis dieser Prozess dann doch nicht vollziehen“
Sorry wenn ich SIe jetzt enttäusche. Ich habe früher auch viele Bücher über die alte und moderne Astrologie und Mystik gelesen. ABer Tatsache:Es ist genau andersherum.WIr haben vorher im Zeitalter der Fische gelebt. Das Zeitalter der Fische ist das Zeitalter von Religion, Spiritualität. Überall auf der Welt blühte Spiritualität, Religion, Kontemplation. In diesem Zeitalter entstanden und verbreiteten sich die großen Weltreligionen wie Christentum, Islam und Buddhismus. Genau dieses Zeitalter geht jetzt langsam zu Ende.
Das Zeitalter des Wassermanns beginnt jetzt bald demnächst. Wir befinden uns gerade in der Gegenwart genau in der Übergangsphase zum neuen Zeitalter.Deshalb ist diese Übergangsphase mit Chaos, Zerstörung, Kataklysmen,Katastrophen,Revolutionen udn Zerstörung der alten Weltbilder verbunden , welche wir aus dem alten Fische-Zeitalter kennen .
Dazu noch ein passendes Zitat:
Bibel
Das Christentum soll zufolge dem Film Zeitgeist (2007) das Fischezeitalter symbolisieren. Jesus machte den Fischer Simon Petrus zu einem „Menschenfischer“. (Lk 5,10 EU)[1]
Der Fisch wurde innerhalb der ersten Jahrhunderte zu einem Symbol für das Christentum und ist heute eines seiner wichtigsten.
Das altgriechische Wort ΙΧΘΥΣ (Ichthys = Fisch) stehe für Iesous Christos Theou Yios Soter (Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter/Erlöser).
In der Anthroposophie wird das Wassermannzeitalter mit einer in rund 1500 Jahren beginnenden sechsten „Kulturepoche“ gleichgesetzt. Nach Angaben der anthroposophischen Astrologin Gisela Gorrissen findet der astronomische Zeitalterwechsel ab 2200 statt, aber die eigentliche Kulturepoche des Wassermannes – das „johanneische Zeitalter der Bruderliebe“ (nach der sechsten Gemeinde „Philadelphia“ der Sieben Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes) – beginne aufgrund der notwendigen Bewusstseinsevolution erst etwa 1400 Jahre später, also im Jahr 3600, was mit den Berechnungen von Rudolf Steiner ungefähr übereinstimmt.