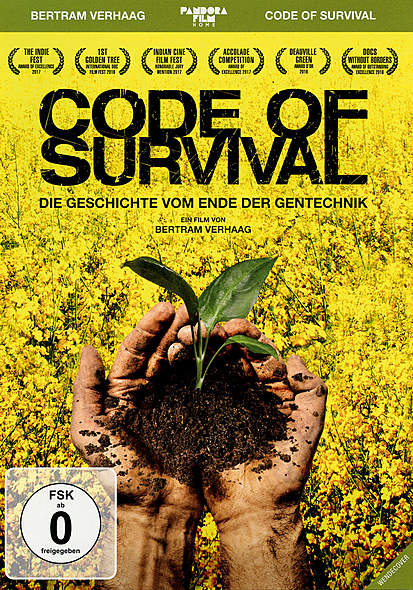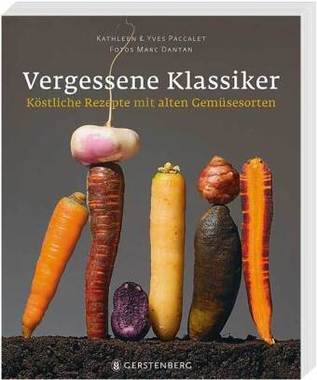„Wer die Saat hat, hat das Sagen“, lautet ein Sprichwort. Das Sagen könnten bald nur noch große Konzerne haben. Doch es wachsen Alternativen heran. Leo Frühschütz
Egal, ob wir Tomaten in den Salat schneiden, ein Vollkornbrot essen oder Reis kochen. Alle diese Lebensmittel können wir nur genießen, weil zuvor ein Landwirt Samen ausgesät hat. Ohne diese Samen könnten wir nicht überleben, das macht sie so wertvoll. Kein Wunder, dass sich auch Chemiekonzerne wie Bayer oder ChemChina dafür interessieren.
Die Idee, mit Samen das große Geschäft zu machen, ist relativ neu. Bis vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, dass ein Bauer oder Gärtner aus der Ernte Saatgut zurückbehielt und es im nächsten Jahr wieder aussäte. Man tauschte mit den Nachbarn, probierte mal eine neue Sorte aus und war unabhängig von Lieferanten. Für die Konzerne ist ein Bauer, der nur einmal Saatgut kauft und danach Samen aus der Ernte behält und neu aussät, jedoch uninteressant. Sie haben Wege gefunden, das zu ändern. Hybrid-Sorten ist einer davon, Patente ein anderer.
Mit Hybridsorten wird eine erfolgreiche Neu-Aussaat verhindert. Denn die Samen aus Hybrid-Gemüse oder -Getreide besitzen die positiven Eigenschaften wie „hoher Ertrag“ oder „einheitliche Früchte“ nicht mehr. Ihr Nachbau macht damit keinen Sinn (genauere Informationen zu Hybrid-Pflanzen finden Sie unter diesem Text).
Durch Patente auf Gemüse, Getreide und Obst erhält der Patentinhaber für einen bestimmten Zeitraum das alleinige Verfügungsrecht über seine „Erfindung“. Er kann ohne Wettbewerb die Preise festlegen und für jede Nutzung Lizenzgebühren verlangen. Das ist beispielsweise bei gentechnisch veränderten Pflanzen der Fall.
Die großen Chemie- und Saatgutkonzerne versuchen zunehmend, auch gentechnikfreie Züchtungen durch Patente schützen zu lassen. 220 Patente auf herkömmliche Züchtung hat das Europäische Patentamt bereits erteilt, sie betreffen Melonen, Tomaten, Zwiebeln, Salat oder Gurken. 1600 Anträge warten auf Bearbeitung, hat das Bündnis „Kein Patent auf Saatgut!“ ermittelt.
„Diese Patente sind ein rechtlicher Trick, um die Grundlagen unserer Ernährung in das ‚geistige Eigentum’ einiger großer Konzerne zu verwandeln“, kritisiert Bündnis-Sprecher Christoph Then (Verbotenes Gemüse: Altes Saatgut (Video)).
Kleine Züchter, Vielfalt und Bauern bleiben auf der Strecke
Seit ein paar Jahren konzentriert sich das Züchtungsgeschäft auf immer weniger Firmen. Erst kauften die großen Pestizidkonzerne wie Monsanto Züchtungsunternehmen auf. In den vergangenen drei Jahren fusionierten die Branchenriesen im Saatgut- und Pestizidgeschäft untereinander: Die deutsche Bayer AG kaufte die US-Firma Monsanto, das chinesische Unternehmen ChemChina übernahm die Schweizer Firma Syngenta, die beiden amerikanischen Chemiekonzerne DuPont und Dow Chemical legten ihr Agrargeschäft zusammen und nennen es jetzt Corteva.
Der deutsche Chemiekonzern BASF blieb solo, übernahm aber von Bayer einen Großteil von dessen Saatgutgeschäft, etwa den Gemüsezüchter Hild. Experten des Internationalen Gremiums für nachhaltige Lebensmittelsysteme (IPES-Food) haben errechnet, dass die vier Konzerne weltweit über 60 Prozent des verkauften Saatgutes und 80 Prozent aller Pestizide herstellen.
Bio-Verbände sowie umwelt- und entwicklungspolitische Organisationen warnen seit Jahren vor dieser Marktmacht. Die Konzerne würden „weltweit kleinere Züchter verdrängen, Artenvielfalt zerstören, Druck auf politische Entscheider entfalten und mittels Patenten Bäuerinnen und Bauern in Abhängigkeit bringen“, beschreibt Jürgen Maier, Geschäftsführer des Forums Umwelt und Entwicklung, die Folgen (Kleingärtner als Schwerkriminelle: 25.000 Euro Strafe für den Anbau alter Obst- und Gemüsesorten (Video)).
Die Macht auf dem Acker – Vier Konzerne dominieren den Saatgut- und Pestizidmarkt: Bayer, BASF, ChemChina und Corteva
Denn gezüchtet wird, was Geld bringt. Die Konzerne konzentrieren sich dabei auf die konventionelle, industrialisierte Landwirtschaft. Dort wachsen die Pflanzen in einem Überangebot an Nährstoffen wie Stickstoff heran. Synthetische Pestizide, die die Konzerne gleich mitverkaufen, schützen die Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen. Wichtige Zuchtziele sind Höchsterträge, Lagerfähigkeit und gutes Aussehen.
Doch Bio-Landwirte und Bio-Gärtner wirtschaften ohne Kunstdünger und Pestizide. Deshalb brauchen sie andere Pflanzen: Solche, die den Boden gut durchwurzeln, möglichst effektiv mit den zur Verfügung stehenden Nährstoffen umgehen und sich gegen Unkraut und Schädlinge behaupten können.
Die profitorientierte Züchtung hat noch einen weiteren Nachteil. Sie gefährdet die Vielfalt. Denn die großen Züchter konzentrieren ihre Anstrengungen auf absatzstarke Arten, alle anderen werden kaum noch weiterentwickelt. Global gesehen liefern nur noch 30 Pflanzenarten 95 Prozent der pflanzlichen Nahrungsmittel, schreibt das Bundesamt für Naturschutz. Die wichtigsten sind Weizen, Reis und Mais. Dabei wären rund 30 000 Pflanzenarten für den Menschen nutzbar.
Die Welternährungsorganisation FAO schätzt, dass die Vielfalt der Kulturpflanzen während des 20. Jahrhunderts um 75 Prozent zurückgegangen ist. Auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpflanzen in Deutschland stehen 2600 Arten und Sorten: etwa Haferwurzel, Gartenmelde und Spörgel, aber auch über 100 regionale Weizensorten und ebensoviele Tomatensorten. „In den alten samenfesten Sorten steckt die ganze Anpassungskraft der Pflanzen“, sagt Susanne Gura, Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN). „Diese Anpassungsfähigkeit brauchen wir, um Pflanzen zu züchten, die ohne Agrarchemie auskommen und sich an Umweltveränderungen anpassen können.“
Bio-Saatgut: regional angepasst und zur Nachzucht geeignet
Damit haben einige Bio-Gärtner bereits vor 30 Jahren begonnen. Sie züchten und vermehren Pflanzen für die Bedürfnisse des Öko-Landbaus. Entstanden ist daraus der Verein Kultursaat. Er koordiniert und finanziert die Erhaltung bestehender sowie die Züchtung und Anmeldung neuer Sorten. Über hundert sind inzwischen zugelassen. In jeder von ihnen stecken zehn bis fünfzehn Jahre Arbeit und mindesten 600 000 Euro an Kosten. Vertrieben werden die Sorten von der Bingenheimer Saatgut AG. Neben Kultursaat gibt es weitere Vereine und Unternehmen, die sich der Öko-Züchtung verschrieben haben.
Alle ökologisch gezüchteten Sorten sind samenfest. Ihr Saatgut kann – anders als bei Hybriden – zur Nachzucht verwendet werden. Ganz wichtig auch: Die Öko-Sorten gehören nicht dem Züchter. „Wir wollen, dass Sorten ein Gemeingut bleiben und nicht für einseitige Profitinteressen privatisiert werden“, erklärt Kultursaat-Geschäftsführer Michael Fleck.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Verein Agrecol mit seiner Open-Source-Saatgut-Lizenz (OSS). Bauern und Gärtner können unentgeltlich eine Lizenz erwerben und damit das Saatgut unentgeltlich nutzen und weiterentwickeln. Dabei räumen sie zukünftigen Nutzern des Saatguts die gleichen Rechte ein. Kurz: Alles, was aus einem OSS-lizenzierten Saatgut entsteht, kann nicht mehr privatisiert werden. Acht Sorten, vor allem Tomaten und Weizen, haben derzeit eine OSS-Lizenz.
„Das Interesse an Saatgut von Sorten aus ökologischer Züchtung wächst stetig“, sagt Petra Boie, Geschäftsführerin der Bingenheimer Saatgut AG. Zahlreiche Bio-Läden verkaufen im Frühjahr die Saatguttütchen und sie bieten auch Gemüse aus Öko-Zucht an, etwa die Möhre Rodelika, den Hokkaido-Kürbis Red Kuri oder die Pastinake Aromata. Oft ist es eigens ausgelobt. Derzeit testet die Bio-Branche zusammen mit dem Öko-Züchterverein Bioverita eine einheitliche Kennzeichnung mit dem Spruch „Bio von Anfang an“. Denn noch stammt auch im Bio-Laden das meiste Gemüse aus konventionell gezüchtetem Hybridsaatgut: Weil es schön einheitlich aussieht, günstiger ist und deshalb bevorzugt gekauft wird (Alte Saat: Darum müssen wir sie bewahren (Videos)).
Bio-Branche unterstützt Öko-Züchtung
Die Naturkost-Branche unterstützt die Öko-Züchtung auch mit Geld. So zahlen Bio-Importeure und Bio-Großhändler im Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) 0,015 Prozent ihres Obst- und Gemüseumsatzes in einen Fördertopf. Auch Stiftungen wie die Zukunftsstiftung Landwirtschaft mit ihrem Saatgutfonds oder einzelne Bio-Hersteller fördern die Züchter. Deren Arbeit kommt zwar der Allgemeinheit zugute, muss aber dennoch bezahlt werden.
Noch liegt die Macht über das Saatgut bei den vielen Millionen Kleinbauern auf der Welt. Denn bislang werden nur 20 Prozent des weltweit genutzten Saatguts durch Handel erworben, 80 Prozent gewinnen die Bauern nach wie vor durch Nachbau und Tausch, insbesondere in Asien und Afrika. Doch genau dort sehen die Konzerne ihre Chancen für Wachstum und neue Geschäfte (Kleingärtner als Schwerkriminelle: 25.000 Euro Strafe für den Anbau alter Obst- und Gemüsesorten (Video)).
Ihr Werkzeug dafür ist unter anderem das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV). Es versucht, den in den Industrieländern üblichen Sortenschutz auch in Entwicklungsländern durchzusetzen – mit Hilfe der dortigen Regierungen. Damit würde chemieabhängiges Hochertragssaatgut die angepassten Sorten der Kleinbauern verdrängen. Saatgut mit Sortenschutz darf zwar im Gegensatz zu Patentsaatgut von Züchtern ohne Erlaubnis und Lizenzgebühren weitergezüchtet werden.
Doch nur die Sorteninhaber, also die Konzerne, dürfen das Saatgut vermehren, aufbereiten und verkaufen. Wollen Landwirte aus der Ernte gewonnenes Saatgut erneut aussäen, müssen sie dem Züchter dafür eine sogenannte Nachbaugebühr zahlen. Dagegen engagieren sich zahlreiche Organisationen, bei uns und in den Ländern des Südens. Sie alle setzen sich dafür ein, das die Bauern das bleiben, was sie zehntausend Jahre lang waren:
die Hüter des Saatguts (Alte Saat: Darum müssen wir sie bewahren (Videos)).
Hybrid-Pflanzen: Saatgut mit Kopierschutz
Bei Hybrid-Pflanzen zwingen Züchter die Elternlinien über Generationen hinweg zur Selbstbefruchtung, also zur Inzucht. Dadurch übertragen sich erwünschte Eigenschaften wie Fruchtfarbe oder Resistenz sicher auf die nächste Generation.
Kreuzt der Züchter zwei Inzuchtlinien, gewinnt er Hybridsaatgut. Auf Samentütchen ist dieses Saatgut mit „F1“ gekennzeichnet. Daraus wachsen Pflanzen, die die positiven Eigenschaften beider Elternlinien vereinen, besonders hohe Erträge und einheitliche Früchte liefern.
Doch schon in der nächsten Generation verlieren sich diese Eigenschaften. Die Samen der F1-Generation-Pflanzen taugen nicht für eine Aussaat. Es muss also neues Saatgut gekauft werden. Der größte Teil unseres Gemüses (außer Salate und Bohnen), die meisten Sonnenblumenkerne und Maiskörner sowie ein Teil von Raps und Roggen stammen von Hybriden – auch im Öko-Landbau (Saatgut wie in alten Zeiten: Mit dieser Liste schlagt ihr Monsanto und Co. ein Schnippchen).
Literatur:
Frisches Gartengemüse auch im Winter: Anbau und Ernte 40 ausgewählter Kulturen
Meine kleine Farm: Anleitung für Selbstversorger
Quellen: PublicDomain/schrotundkorn.de am 26.09.2019